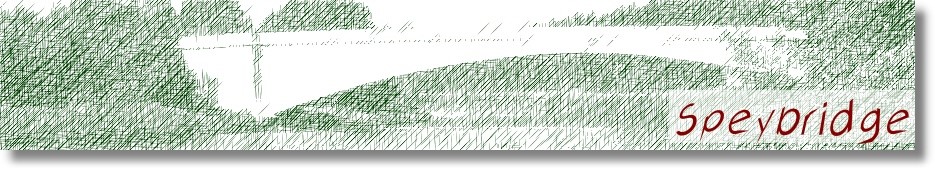Inspiration und Transpiration
Anlässlich der Vergabe der Nobelpreise in diesem Jahr ist auf WELT-ONLINE eine Artikel mit dem Titel Das Geheimnis der Genies zu finden.
Dort wird u.a. über den Zusammenhang zwischen Hochbegabung und der Wahrscheinlichkeit, den Nobelpreis zu erhalten berichtet – mit der Frage, was die klügsten Köpf unserer Zeit von den gewöhnlichen wohl unterscheidet.
Der Weg, über das Sezieren und die Analyse des Gehirns von Einstein (schon 3 Stunden nach seinem Tod), Aufschluss bezüglich des Wesens der Genialität zu erhalten, erwies sich letztlich als nicht besonders aufschlussreich.
Die Beobachtung von 250.000 Jugendlich, davon 1500 hochbegabt, über 70 Jahre hin zeigte: “Viele der Überflieger besetzten zwar Spitzenpositionen, ihr Einkommen war in der Regel hoch. Überraschend aber auch: Die brillant intelligenten Köpfe waren erfolgreich – aber keinesfalls die erfolgreichsten. Keiner dieser Hochbegabten bekam den Nobelpreis, die Fields-Medaille, den Pulitzerpreis. Dafür aber einige hochbegabte Kinder, die Terman als nicht intelligent genug von seiner Untersuchung ausgeschlossen hatte – darunter William Shockley und Luis Alvarez. Beide wurden Jahrzehnte später mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet.”
Gründe: “Dass ungewöhnliche Intelligenz nicht automatisch großer Erfolg bedeutet, ist unter Naturwissenschaftlern eine Binsenweisheit. Thomas Alva Edison, der die Glühbirne erfand, hat die Sekundärtugenden neben dem Genie gewichtet: “Ein Prozent Inspiration, 99 Prozent Transpiration.” Edisons Flapsigkeit ist statistisch unterfüttert. Der aus Ungarn stammende Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi hat sich 91 kreative Köpfe vorgeknöpft – Schriftsteller, Musiker, Physiker, Biologen, viele Nobelpreisträger.
Keine der Persönlichkeiten erfüllte das Klischee vom entspannten Überflieger. Sämtliche erfassten Denker und Schöpfer waren harte Arbeiter – sie waren sogar von Arbeit regelrecht besessen. Erfolgreiche Kreative, so fasst es der Ungar zusammen, ‘machen Überstunden, arbeiten mit höchster Konzentration’.”
Zum Erfolgsrezept gehören neben IQ, Inspiration und Transpiration noch, nach Rost, “‘Erstens gute Beziehungen. Schüler von Preisträgern haben nachweislich bessere Chancen. Zweitens muss das wissenschaftliche Umfeld stimmen. Ebenso wichtig sind ein guter Mentor und natürlich hohe Leistungsbereitschaft.'”
Auch noch erforderlich: Kreativität. Dabei hat sich in Studien herausgestellt, dass wohl tatsächlich “Genie und Wahnsinn” in bestimmter Hinsicht eng zusammenliegen: “Sowohl Schizophrene als auch Kreative haben, wie es scheint, die Neigung, alle Reize, die in ihr Gehirn eintreffen, unsortiert als gleichwertig wahrzunehmen. Risiken und Nebenwirkungen eingeschlossen: Die Gefahr ist, in der Reizflut unterzugehen, mit Denkstörungen und Halluzinationen, den beiden Kardinalsymptomen der Schizophrenie. Den Kreativen gelingt es dagegen, das Chaos zu nutzen.”
Besonders groß war das beobachtete Risiko bei Mathematikern: “Geisteswissenschaftler sind genetisch unbelastet. In ihren Familien kommen Psychosen nicht häufiger vor als im gesellschaftlichen Mittel. Anders sieht das bei den Mathematikern aus: Zwei bis drei Mal so viele Psychosen wie erwartet plagen ihre Familien.”, so das Ergebnis einer Studie des Isländers Jon Karlsson.
Gar nicht so leicht, Nobelpreisträger zu werden…