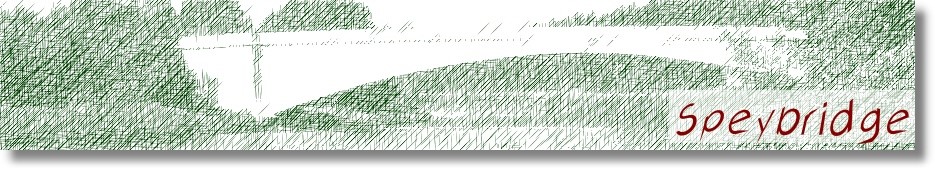Studien zum Verlust der Sprach- und Schreibfähigkeit
Ich liebe Sprache. Wirklich. Sehr.
Meine Freunde haben längst akzeptiert, dass ich unter E-Mails, Nachrichten und Twittermeldungen leide, die schlecht geschrieben sind und viele Fehler enthalten – und ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie das respektieren und mir den Freundschaftsdienst erweisen, im schriftlichen Austausch mit mir darauf Rücksicht zu nehmen. Dafür bin ich dankbar.
Ich bin nicht etwa zwanghaft pingelig, sondern liebe und achte unsere Sprache mit ihren Möglichkeiten zur differenzierten Aussage, die sie uns – von albernstem Spott bis hin zu Reflexionen in tiefste Tiefen hinein – schenkt, wirklich von Herzen. Was man liebt, wünscht man sich von anderen zumindest respektiert.
Manchmal bewundere ich ehrfürchtig, was sie in welch großer Schönheit zu leisten vermag, manchmal taste ich mich an den Grenzen der Sprache entlang und versuche, ihr im Ausdrücken von eigentlich Unsagbarem noch einen erhellend stimmigen Satz abzuringen. Manchmal auch spiele ich mit ihr wie ein übermütiges Kind und reize sie aus in ironischen Kommentaren oder absurden Wortspielen. Nie aber ist sie mir gleichgültig, die Sprache, und wenn sie missachtet wird, tut mir das wirklich weh.
Was ich aus meiner persönlichen Sicht zutiefst bedaure, beklagen viele Ausbilder, Unternehmer und Personalchefs auch aus objektiv absolut nachvollziehbaren Gründen: Die Sprachfähigkeit, insbesondere die Schreibfähigkeit, der Schüler, Jugendlichen und dann auch der Erwachsenen nimmt rapide ab.
Dass das tatsächlich so ist, hat eine aufwändige und über 40 Jahre betriebene Studie belegt. Näheres findet sich im Artikel der ZEIT mit dem Titel: Wenn Freiheit überfordert.
Generelles Fazit der Studie: ”Die Fähigkeit der Schüler, Texte orthografisch korrekt und grammatikalisch normgerecht zu schreiben, hat im Durchschnitt stark abgenommen. … Besonders deutlich fallen die Befunde zur Rechtschreibung aus: Die Zahl der Fehler pro hundert Wörter stieg von durchschnittlich sieben im Jahr 1972 auf zwölf im Jahr 2002 an und dann noch einmal auf 17 Fehler im Jahr 2012.”
Interessant dabei ist, dass Schüler mit Migrationshintergrund nicht mehr Fehler produzieren als “ihre deutsch-monolingualen Klassenkameraden”.
Es geht aber nicht nur um Rechtschreibfehler und Grammatik, sondern auch um die zunehmende Unkenntnis von Strukturen und Textformen. In den letzten Jahren z. B. wurde der Aufgabe, eine Bildergeschichte in Worte zu fassen, also eine schlichte Nacherzählung anzufertigen, vermehrt nicht mehr im Sinne der Aufgabenstellung nachgegangen, sondern es fanden sich häufig Wertungen, Kommentare, Meinungsäußerungen und Fragen an den Autor im Stile von "Ich fant den Film gemein aber das Madchen ist auch selber schult daran das die anderen Kinder die Puppe wekgenommen haben." oder "Wie heisen die kinder???" – sowie Internetsymbole wie Smileys.
Diese Vermischung der “wertfreien”, schlichten Wiedergabe eines vorgegebenen Inhaltes mit launigen Meinungsäußerungen und Wertungen im Internetkommentarstil “Das ist voll blöd” halte ich noch für viel schlimmer als die stark gestiegene Zahl der Rechtschreib- und Grammatikfehler. Sie zeigt nämlich eine zunehmende Undifferenziertheit auch im Denken und die Tendenz zur narzisstischen Aneignung vorgegebener Wirklichkeit und ihrer Ausdrucksformen. Wie eng Sprache und Denken zusammenhängen, das zeigt die umfangreiche Literatur zu diesem Thema.
Sehr bedenklich finde ich dieses wachsende Unvermögen, Sachverhalt und eigene Meinung auseinanderzuhalten, auch in – im weitesten Sinne – politischer Hinsicht, da die sich hier zeigende Undifferenziertheit anfällig macht für Propaganda und jegliche Form von Manipulation. Diese werden oft einfach nicht mehr erkannt, weil das dazu notwendige “Werkzeug” nicht ausgebildet wurde. So wird es z. B. für viele immer schwieriger, zwischen der eventuellen Notwendigkeit einer (politischen) Sachentscheidung und dem eigenen “Das ist einfach Scheiße” zu unterscheiden. Schon heute zeigt sich selbst in wissenschaftlichen Arbeiten von Studenten eine erschreckende Vermischung von Fakten, Analyse und persönlicher Meinung.
Positiv an der Entwicklung der Schreibfähigkeit in den letzten 40 Jahren sind die gestiegene Lebendigkeit und Ausdrucksstärke der Texte und ein vergrößerter Wortschatz. Trotzdem aber sind auch diese positiven Tendenzen seit 2002 wieder rückläufig. Vor allem relativiert ein Faktum diesen an sich zu begrüßenden Fortschritt: Gestiegener Wortschatz und lebendigere Ausdrucksweise finden sich vornehmlich bei Schülern der oberen/unteren Mittelschicht.
Damit kommen wir zum eigentlichen Dilemma der Schreibentwicklung, das der Untertitel des ZEIT-Beitrages so zusammenfasst: “Eine Studie über die Schreibfähigkeit von Grundschülern zeigt: Zu lockerer Unterricht schadet den Schwachen”.
Erschreckend ist, dass die Liberalisierung des Sprachunterrichtes in den letzten Jahrzehnten mit dem damit verbundenen und immer konsequenter werdenden Wegfall verbindlicher Vorgaben gerade denjenigen schadet, die Unterstützung besonders benötigen: “Die soziale Schicht, der die Kinder entstammen, hat heute einen viel größeren Einfluss auf ihre Schreibfähigkeiten als vor 40 Jahren.”
Erschütternd!
Man verstehe mich nicht falsch: Keiner wünscht sich eine Rolle rückwärts zum Sprach-Drill vergangener Jahrzehnte. Freiere Ausdrucksweise und gestiegenen Wortschatz begrüße ich sehr, sind aber schon wieder rückläufig und waren zudem nur schichtspezifisch zu finden – und vor allem: Kinder bildungsfernerer Schichten gehen heute sprachlich deutlich schlechter ausgerüstet ins Leben als vor 40 Jahren. Vor diesem Hintergrund halte ich es für dringend geboten, Sprachunterricht umfassend zu reformieren. So, wie er heute ist, scheint er niemandem zu nutzen. Hier gibt es nur Verlierer – und die Sprache selbst gehört auch dazu.
Eine falsch verstandene Liberalisierung des Sprachunterrichtes scheint zum Irrweg geworden zu sein.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ludwig Wittgenstein
Nachtrag:
Wie für diesen Beitrag bestellt, erschien heute auf SPIEGEL ONLINE auch noch ein Interview mit der Jura-Professorin Jantina Nord: Sprachtest für Jurastudenten: "Das Ergebnis war teils verheerend".
Auch hier das Fazit – in Wiederholung des Titels: “Leider war das Ergebnis teils verheerend.”. Man kann es erheiternd finden, dass angehende Juristen das Wort “verlustig gehen” von “lustig” ableiten oder “sich übervorteilt fühlten” mit “besonders günstig davongekommen” assoziieren, wenn man aber bedenkt, dass Sprache das wichtigste Werkzeug der Juristen ist und man im Ernstfall vor Gericht auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, dass diese wissen, was sie tun, wird einem ganz schlecht.
Nord weist darauf hin, dass mangelnde Sprachkompetenz natürlich nicht nur bei Jurastudenten zu finden ist: “Kollegen aus allen Fachbereichen beklagen das Problem. Es gibt etwa Architekturstudierende, die hervorragende Entwürfe liefern, aber nicht beschreiben können, was sie gemacht haben. Viele Professoren winken dann ab und sagen, es sei ja nicht ihr Job, den Erstsemesterstudierenden Deutsch beizubringen. Wenn Maschinenbauer kein Mathe können, bekommen sie ein Propädeutikum Mathematik. Das ist beim Sprachthema anders.”
Im Übrigen macht die Juristin nicht die spezifische Fachsprach der Juristen für den mangelhaften Umgang mit Sprache verantwortlich: “Wir müssen … schon einen Schritt früher ansetzen, nämlich bei den ganz banalen Themen Rechtschreibung, Verständlichkeit und Grammatik.”